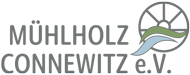Historisches
Wie entstand der Vereinsname Mühlholz Connewitz e.V.?
Ein kleiner Rückblick in die Historie zum Mühlholz und zur Mühlholzgasse in Connewitz beantwortet diese Frage.
Während der Völkerwanderung im 6. Jahrhundert kamen sorbische Stämme in unsere Gegend und gründeten neben dem Dorf Connewitz (Ort der Pferdehirten) auch ein Unterdorf Doberschütz als Fischerdorf (heute am unteren Rand der Mühlholzgasse).
Während der deutschen Besiedlung ab dem 11. Jahrhundert wurden die sorbischen Siedlungsplätze übernommen und deren Kultur assimiliert. Spätestens seit dieser Zeit ist eine Mühle in Doberschütz bzw. Neudorf nachweisbar. Zur Mühle gehörte ein Gut samt Wiesen und Wäldern, dem heutigen Mühlholz.
Da in Connewitz und Doberschütz lange Zeit flämisches Recht galt, ist anzunehmen, das die Flamen (Niederländer) unter flämischen Recht auch den Pleißemühlgraben angelegt haben, um die Wasserzufuhr für die Mühlen zu verbessern. Ursprünglich für mehrere historische Wassermühlen angelegt, zeugt die Mühlpleiße von der Existenz einer jahrhundertelang gewachsenen dörflichen Struktur des historischen Connewitz. Gemeinsam mit den Dölitzer Bauern gruben um 1250 Leibeigene der Rittergüter Doberschütz und Connewitz in einem aufwendigen Landschaftsprojekt von der alten Pleiße abgehend einen Seitenarm, den Mühlgraben: die heutige Mühlpleiße. Es entstanden Wehranlagen, eine Getreidemühle und später im Mittelalter eine Öl- und Gewürzmühle, sowie ein Kupferhammer und ein Schleifwerk sowie eine Pulvermühle zur Metallverarbeitung.

In unserer Reihe Natur- und Erlebnistage nehmen wir Bezug auf diese historischen Wurzeln und geben in regelmäßigen Führungen und Rundgängen durch den südlichen Auwald und entlang der Mühlpleiße zu Fuß und zu Wasser Einblicke in die Entwicklung des heutigen Connewitz von der Geschichte bis in die Gegenwart des 21. Jahrhunderts.
Das Mühlengut samt Neudorf Doberschütz (4 Hufen Land) wurde im Jahr 1275 von den Söhnen des Schultheißen Albrecht an Markgraf Dietrich von Landsberg für 104 Silbermark verkauft. Dieser vermachte seinen Besitz an den Bischof von Merseburg, der wiederum übergab es 1276 dem Thomaskloster Leipzig zur Verwaltung. Aus den ehemaligen Rittergütern wurden nun Klostergüter.
Nach der Reformation 1539 in unserem Teil von Sachsen beauftragte die Stadt Leipzig eine ›Fachkommission‹ mit der Erfassung aller Besitztümer der Klöster in Leipzig. Nach deren Säkularisierung im Jahr 1543 fiel das gesamte Dorf Connewitz samt Neudorf an den Rat der Stadt Leipzig. Aus Klostergut und Mühle wurden nun Ratsdörfer.
Dabei wurden auch fast alle südlichen Waldgebiete einschließlich des Mühlholz an die Stadt Leipzig übertragen, was die Gründung eines Forstreviers Connewitz im Jahr 1563 erforderlich machte. Neben Fronen, weiteren Diensten und anderen Abgaben erhielten die Mühlenpächter das Recht Branntwein herzustellen und Backwaren zu verkaufen.
In der Zeit von 1810 bis 1818 erhielt das Neudorf als Namensgeber der Neudorfgasse und Teil der späteren Roßmäßlerstraße eine Aufwertung durch die Errichtung von 15 neuen Drescher-Häusern. Das Mühlholz wiederum diente als Namensgeber für die Mühlholzgasse. Die Drescher, die in diesen Häusern lebten, leisteten Frondienste in der Mühle. Einige wenige dieser Gebäude kann man heute noch in der Roßmäßlerstraße sehen.
Beide Straßen, Mühlholzgasse und die spätere Roßmäßlerstraße, endeten lange Zeit als Sackgassen etwa auf Höhe des Wendehammers bzw. Knicks im Straßenverlauf. Zur späteren Teichstraße existierte nur ein schmaler Fußweg. Damit markieren Mühlholzgasse und Roßmäßlerstraße das nordwestliche Ende der historischen Siedlung. An diesem Sackgassenende der Mühlholzgasse stand einst ein Armenhaus für die Bewohner des Neudorfes, die keine Miete aufbringen konnten.
In den Jahren 1850 und 1860 entstanden viele Mehrfamilienhäuser im Neudorf. Etwa um diese Zeit wurde auch die Villa im Schweizer Stil für Alphons Dürr, den Biografen Adam Friedrich Oesers in der Neudorfgasse errichtet.
Die einstige Hintergasse, oder spätere Waldgasse wurde nach dem Tod von Emil Adolf Roßmäßler (1867) nach diesem Leipziger Naturforscher, Schriftsteller und Politiker benannt. Er war es auch, der als einer der ersten auf die außerordentliche Schönheit und den ökologischen Nutzen des Leipziger Auwaldes hingewiesen hat.
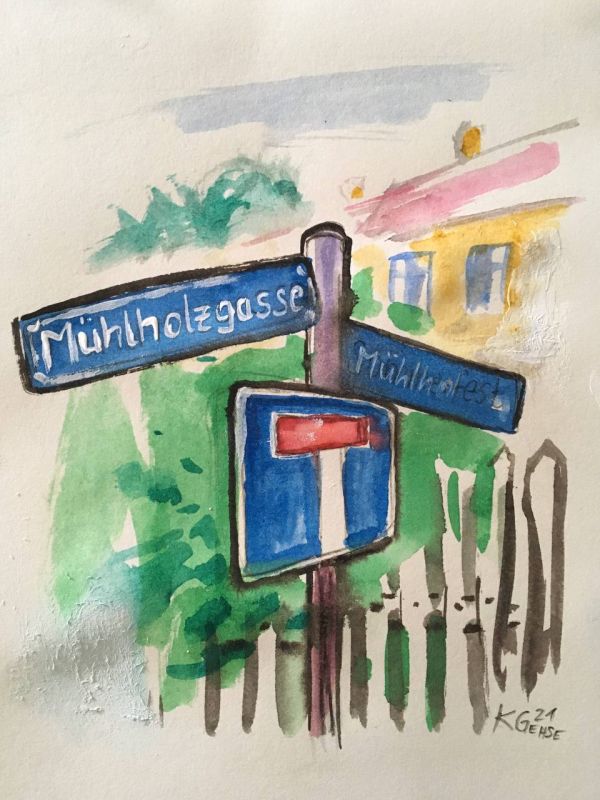
Im Jahr 1891 endete die Selbständigkeit der Dörfer Connewitz und Doberschütz/Neudorf durch die Eingemeindung nach Leipzig. Bereits um die Jahrhundertwende wurden zwei große Mehrfamilienmietshäuser in der Mühlholzgasse gebaut.
Die Entstehung der Steyerschen Villa gegenüber der Mühle fällt etwa in diese Zeit (1907/08). Erst kürzlich wurde die Villa komplett umgebaut und bietet heute mehreren Familien in der Mühlholzgasse ein zu Hause. Der damalige Mühlenpächter Jacob schenkte der Stadt Leipzig im Jahr 1904 einige Damhirsche. Da man zunächst nicht wusste wohin mit den Tieren, hat man sie im Connewitzer Wald in der Nähe der Hakenbrücke eingepfercht. Damit war der Grundstein für den späteren Wildpark gelegt.
Im Jahr 1909 verkaufte der Mühlenpächter Jacob seine am Neudorf gelegenen Wiesen an die Stadt Leipzig. Diese ehemaligen Mühlwiesen neben der Mühlholzgasse wurden in den späten 1930er-Jahren parzelliert und für den Einfamilien-Reihenhausbau vorbereitet. Die Roßmäßlerstraße und die Mühlholzgasse wurden bis zur Teichstraße verlängert, wodurch sie seither keine Sackgassen mehr sind.
Im Bombenhagel des Zweiten Weltkrieges wurden große Teile der Villa Steyer und des Mühlengutes stark beschädigt. In den verbleibenden Gebäudeteilen siedelten sich Dachdecker, Karosseriewerkstätten und ein Autohaus an.
In den 1970er-Jahren lebte der beliebteste Sportler der DDR, Gustav Adolf „Täve“ Schur (geb. 23.02.1931) mit seiner kinderreichen Familie im Einfamilienhaus Mühlholzgasse 59.
Das Ortsbild blieb lange Zeit dörflich-idyllisch, bis in den 1980er und 1990er-Jahren der Abbruch vieler alter Bauernhäuser begann. Die Baulücken wurden besonders nach der Jahrtausendwende mit Einfamilien-Stadthäusern geschlossen, die das heutige Bild prägen.
Historischer Text:
Axel Rehm mit Ergänzungen von Stephanie Dathe
Quellenverzeichnis.:
- Paul Altenburger, Die Entwicklung des Vorortes Connewitz, 1926
- Michael Liebmann, Connewitz vom Werden Eines Stadtteils, 2015
- Axel Rehm, Leipzigs Wälder. Städtisches Grün in Geschichte und Gegenwart, 1996
- Akten des Stadtarchivs Leipzig/Wikipedia